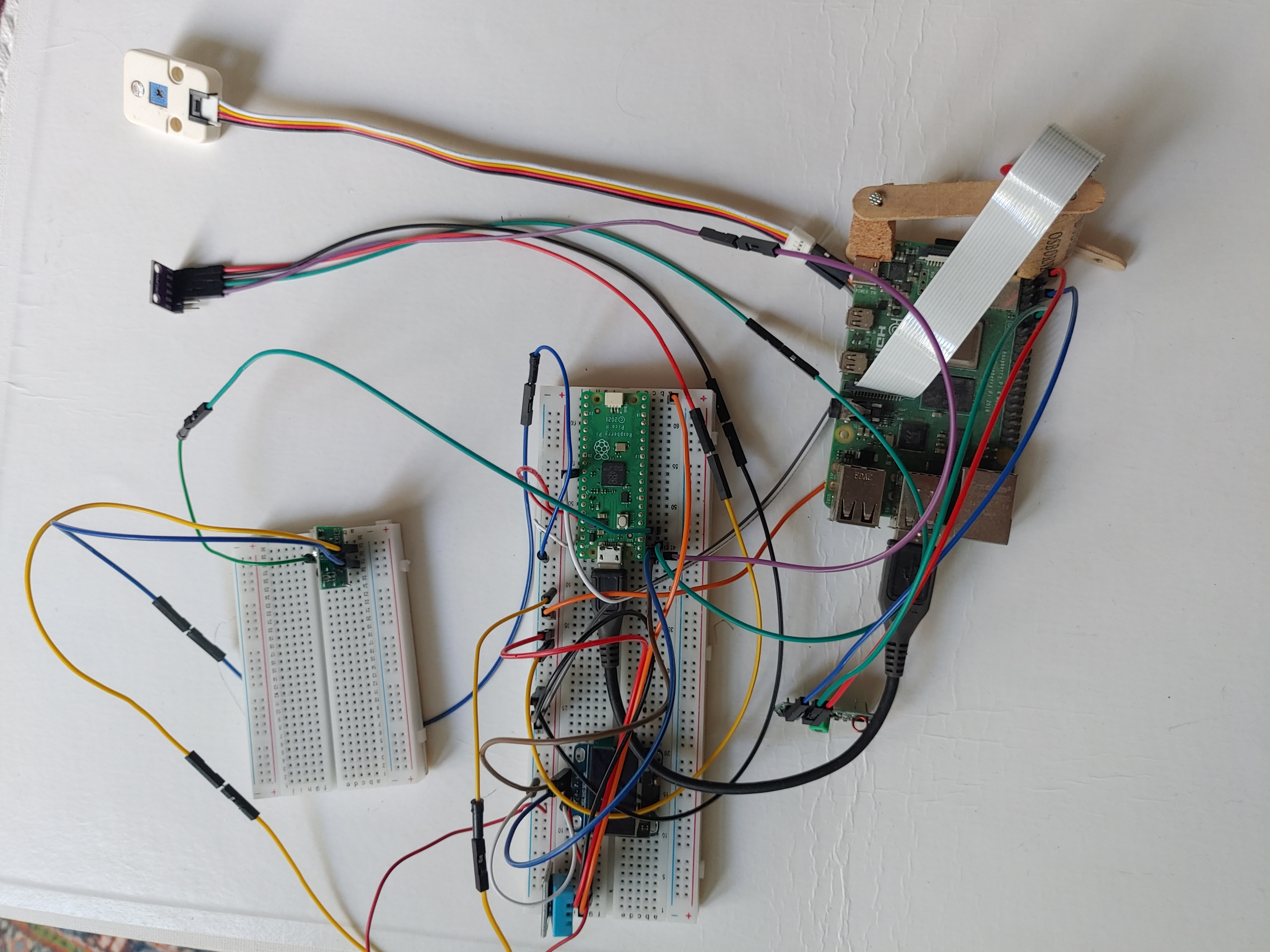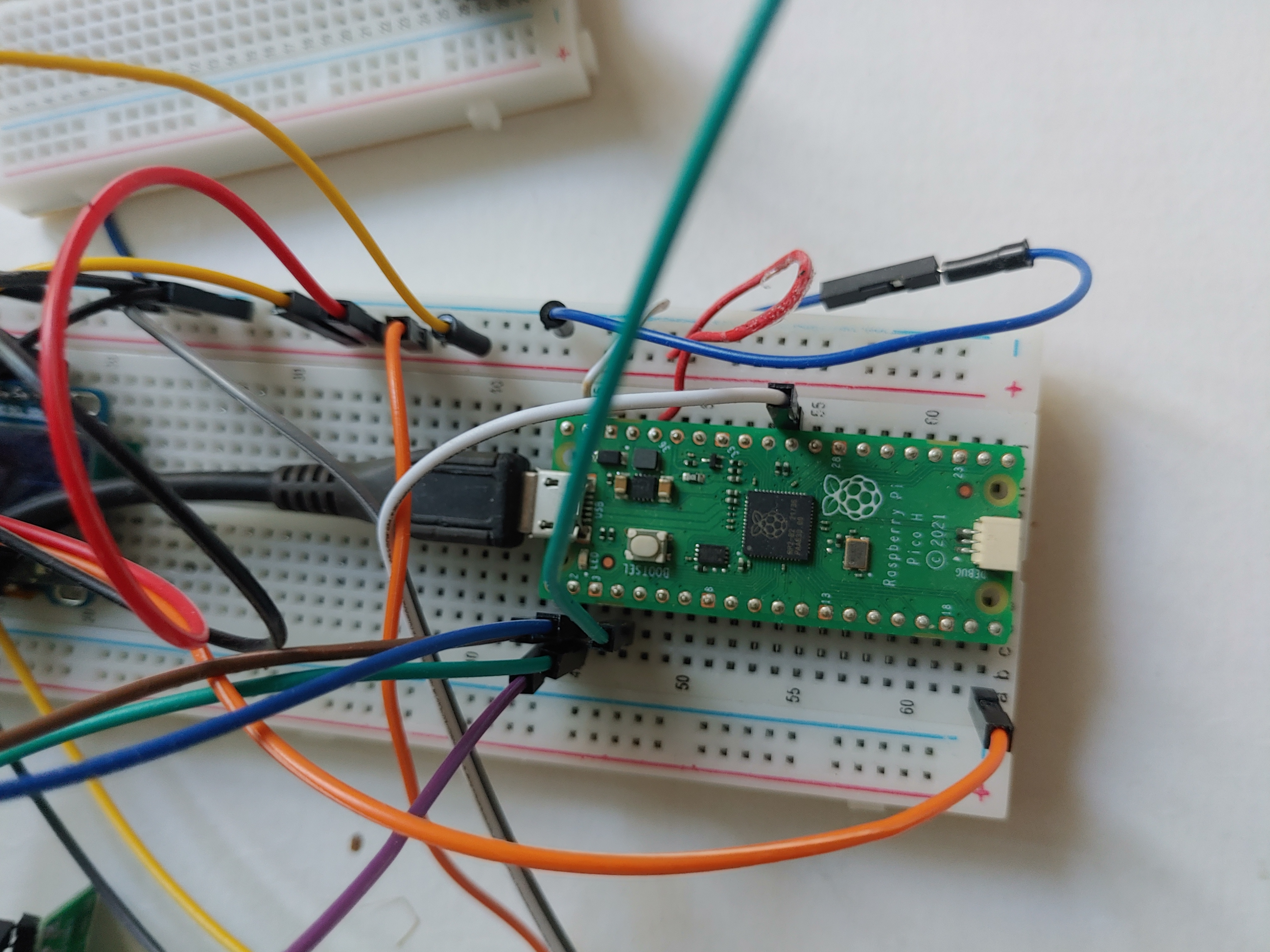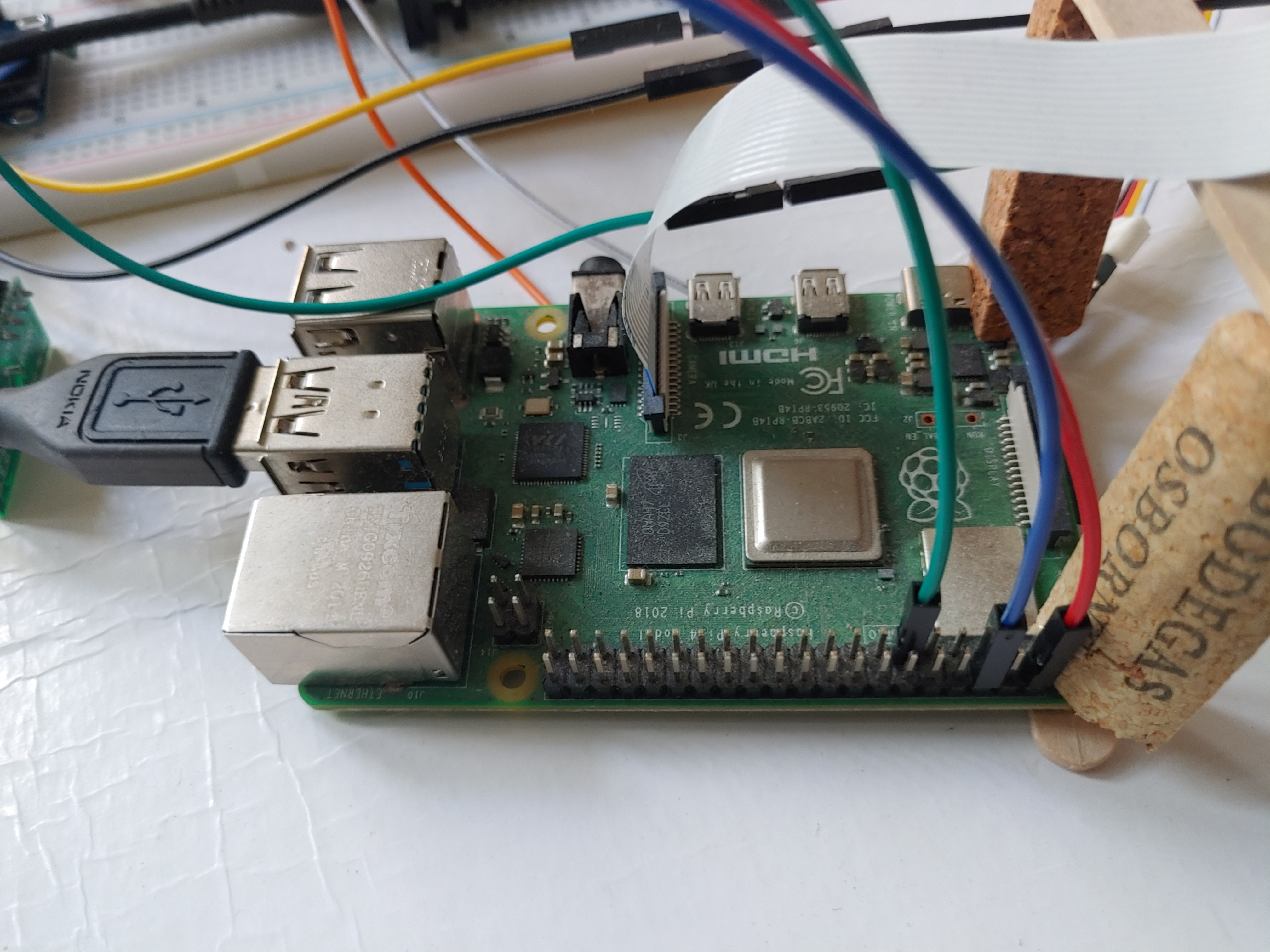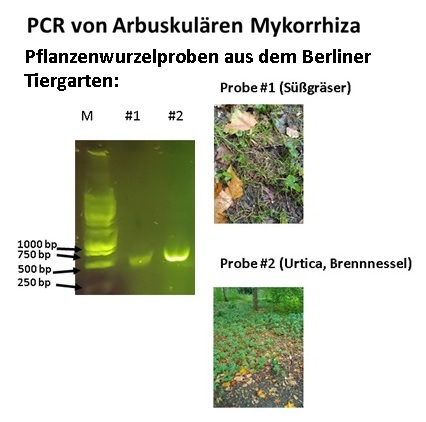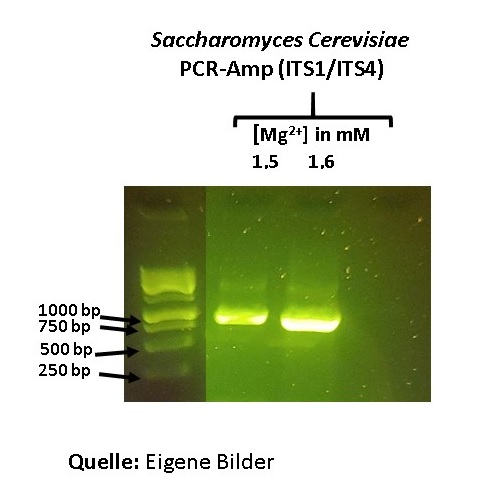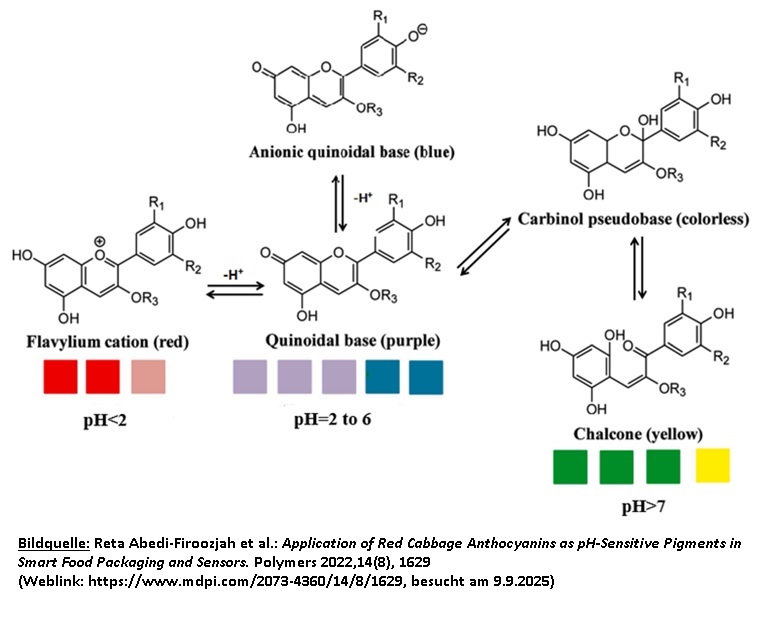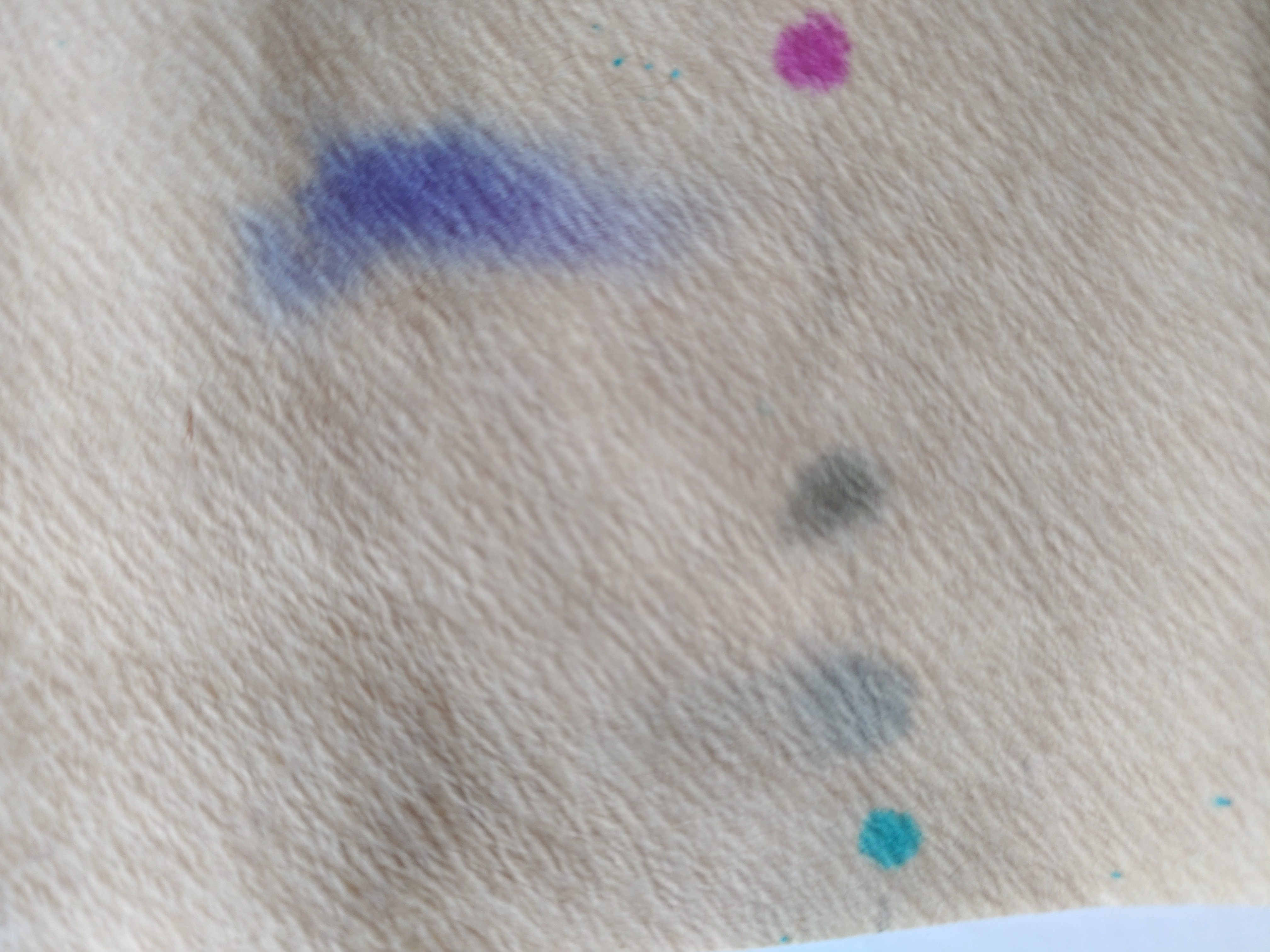Heilige Geometrie
Die Doppelspirale ist eines der beeindruckensten Muster in der heiligen Geometrie. Ihr Vorkommen in der Natur offenbart eine fundamentale Ordnung, die von der mikroskopischen Ebene bis in die Weiten des Kosmos reicht.
Ihr prominentestes und lebenswichtigstes Vorkommen ist die DNS.
In der Botanik finden wir sie, wo sich Blätter oder Samen oft abwechselnd um einen Stamm anordnen ( siehe linke Fotos). Sogar gewaltige Galaxien zeigen oft eine zweigeteilte spiralförmige Struktur, die aus der Dynamik rotierender Energiemassen entsteht.
Mathematisch wird diese Form durch die Fibonacci-Folge und den Goldenen Schnitt (Phi, φ ≈ 1.618) beschrieben. Jede einzelne Spirale der Doppelspirale folgt oft dieser logarithmischen Wachstumssequenz, bei der jedes Glied der Folge die Summe der beiden vorhergehenden ist (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…). Der Quotient aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen nähert sich dem Goldenen Schnitt an. Dieser proportionale "göttliche" Schnitt ist der Schlüssel zur Effizienz und Harmonie dieser Form.
In der heiligen Geometrie repräsentiert die Doppelspirale die Reise der Seele: eine Bewegung von einem Zentrum ausgehend, eine Expansion nach außen (Ausatmen, Geben) und eine gleichzeitige Bewegung zurück zur Quelle (Einatmen, Empfangen). Sie visualisiert die Vereinigung von Gegensätzen – männlich und weiblich, Yin und Yang, Himmel und Erde – und zeigt, dass diese Kräfte nicht im Widerstreit, sondern in einer eleganten, sich gegenseitig verstärkenden Tanzbewegung miteinander verbunden sind.